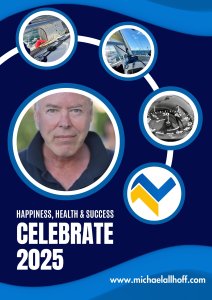Karibische Korallengärten, einsame Mangroveninseln, Hummer fangfrisch aus dem Meer: Das Archipel „Jardines de la Reina« vor der südlichen Küste Kubas zählt zu den ganz abgelegenen Segelrevieren der Erde. Ein Zehn-Tage-Törn unter dem Kreuz des Südens.
Käptn Klaas hat Schiff und Mannschaft souverän unter Kontrolle. Der wuchtige Zwei-Meter-Mann prüft mit einem kurzen Blick auf das GPS unsere Position. »Jetzt hört mal auf zu schwatzen, klar zur Wende!« hallt sein Kommando über das Deck. »Ist klar!« schallt es von Steuerbord. »Re!« brummt der Käptn und wirft das Ruder herum. Der Katamaran schießt in den Wind. »Los die Schot!«
Mit aller Kraft kurbel ich an der Winsch, der Puls rast, Schweißtropfen brennen mir in den Augen. Knatternd killt das Genua einen Moment lang im Wind, bevor das Segel auf dem anderen Bug dichtgeholt ist. »Bei Regatta-Seglern geht das Zack-Zack«, kommentiert Klaas die lasche Wende, »nach sechs Sekunden steht das Segel schon wieder!« Na wunderbar, denke ich mir, echte Seebären wissen halt, wie man Landratten die Leviten liest.

Der Passat frischt auf, Windstärke Sechs vor Kuba bei strahlendem Sonnenschein. Der Mittagshimmel leuchtet tiefblau und das Meer mintfarben wie ein Mojito. Ideales Segelwetter. Mit zehn Knoten Fahrt rauscht die »Lea« unter vollem Tuch durch gischtende Wellen. Knapp 13 Meter lang ist das Segelschiff, ein schnittiger Katamaran, futuristisch designt ganz in Weiß, mit 90 Quadratmetern Segelfläche. Segeln wie Magellan, wie Vasco da Gama, wie Drake: Trotz Hilfsmotor, Kühltruhe und Satellitennavigation haben Segelschiffe bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt.
Ortswechsel. Havanna im Jahre 43 der Revolution. Scheppernd kurvt der rote Buick durch die Gassen der Altstadt. Vor jedem Schlagloch kurbelt der Taxifahrer wild am Lenkrad. Vergeblich! Wieder knallt die ausgeleierte Federung in die Achsen und wir schlingern in dem vorrevolutionären Dinosaurier hin und her wie auf hoher See.
Baujahr 1954, rostig und zerbeult – die Blechkarosse hat schon bessere Zeiten erlebt. Wie die verfallenen Häuser am Malecón. La Habana Vieja, das ist ein baufälliges Bühnenbild in rosa, blau und braun für einen surrealen Film, der von Ideologie und Hoffnung handeln würde, vom süßen Schicksal des Zuckerrohrs, von Tabak, Armut und Musik.
Ich ging zu Fuß weiter und verlor mich in einem morbiden Alptraum karibischer Tristesse. In einem kafkaesken Labyrinth aus kolonialen Fassaden, von denen Farbschichten blättern und der Putz bröckelt. In der Calle Amargura, der »Gasse der Bitterkeit« zwischen Kapitol und Kathedrale, dort wo Wäsche an Leinen auf Balkonen trocknet und gärende Mülleimer den Bürgersteig blockieren, wettern Kubaner auf das Castro-Regime wie einst die 68-er auf die Bourgeoisie. Die Jugend an vorderster Front: Cargo-Hosen sind en vogue und Techno aus Miami. Das System sei doch nur für die Armen gut, schimpft eine schöne Mulattin. Ihr Monatslohn, 250 Pesos, entspricht dem Preis einer Cohiba Esplendido im Export. Sie arbeite und arbeite und komme doch nicht an den Strand. „Hier ändert sich nichts mehr, bis der Alte stirbt!“. Der soziale Idealismus verblaßt wie die Tünche auf den salpeterzerfressenen Hausruinen.
In der Calle Amargura, der Straße der kleinen Freuden und winzigen Gewinne, hat die Revolution mit dem hehren Ideal der klassenlosen Gesellschaft die Unschuld verloren – spätestens, seitdem der kubanische Übervater und comandante en jefe Fidel Castro den Dollar freigegeben hat und clevere Kleinunternehmer wieder Neid und Egoismen schüren, als illegale Taxifahrer, Zigarrenhändler oder Rumverkäufer.
Doch in der Hauptstadt der Salsa und des Son dröhnt Life-Musik aus jeder Häuserzeile. Havanna vibriert vor Lebenslust. In der nostalgischen Bar »El Angel«, im ehrwürdigen »Lluvia de Oro«, in der legendären »Bodeguita del Medio« – überall diese ohrenbetäubend entfesselte Salsa, ein leidenschaftliches Crescendo aus Rumba, Danzón, Mambo und Son, das den Reisenden mitreißt und elektrisiert. Ein ekstatischer Trommeltaumel, synkopierte Gitarren-Akkorde, blecherne Trompeten-Solos, knatternden »Güiros« und Kürbisrasseln, die kirre machen: Es ist eine heftige Musik – leidenschaftlich, pulsierend, verführerisch. Ja, kubanische Rhythmen haben die Welt erobert – mit der CD „Buenavista Social Club“, mit »Irakere«, dem afrokubanischen Latin-Jazz-Ensemble des Pianisten Jesus „Chucho“ Valdés sowie der rockigen Salsa der »Van Van«.
Auch viele der mumifizierten Prachbauten Havannas werden restauriert. Das neoklassizistische Theater García Lorca wie auch das Jugendstil-Hotel Inglaterra zum Beispiel. Und die elegante Calle Obispo mit ihren schmiedeeisernen Balkonen und verschnörkelten Erkern wirft sich in Schale wie eine Tropicana-Tänzerin vor der Show.
„Es wird seinen Grund haben“, rätselt selbst der kubanische Autor Fernando Ortiz, „daß das Leben auf Cuba schon immer so teuflisch verzwickt und würzig war.“ So begann meine Reise, die vom steinernen Irrgarten der Karibik in die einsame Inselwelt der Cayos führen sollte, mit einem wahren Wechselbad der Gefühle.
»Es ist das herrlichste Land, das Menschenaugen je erblickt haben«, notierte Kolumbus über Kuba in sein Logbuch, »man möchte sein ganzes Leben bleiben.« Am 28. Oktober 1492 entdeckte der Segler, der Indien suchte und Amerika fand, dieses karibische Eiland, von den Taino-Indianern Cubanacán genannt. Wir segeln im Fahrwasser des Genuesen, Kurs 120˚ Grad Südsüdost, mitten hinein in den subtropischen Inselgarten »Jardines de la Reina«, die »Gärten der Königin«. Hunderte von weltentrückten Cayos – niedrige Korallenriffe und einsame, von Mangroven bewachsene Inseln mit weißen Korallensandstränden – säumen Kuba wie die Key´s vor Florida. Dieses naturgeschützte Archipel, vom kubanischen Übervater Fidel Castro erst vor wenigen Jahren für Touristen geöffnet, gehört zu den ganz abgeschiedenen Segelrevieren der Welt. Die »Lea« und unser Schwesterschiff »Sangria«, wir sind die einzigen Segler im Umkreis von Hunderten von Meilen.
79,1 Grad Länge, 21,3 Grad Breite: Ankerfall vor dem einsamen Atoll Cayo Cuervo, 40 Seemeilen vor der Küste. Das Inselchen der Glückseligen ist kaum größer als ein Fußballplatz. Sonnenlicht flimmert in Mangroven und das Meer ringsum leuchtet Aquamarin wie ein Cocktail mit Curaçao. Wir schwimmen zum Strand und lassen uns in den heissen Sand fallen, der unter den Füßen stäubt wie Puderzucker. Sonnenbaden. Muscheln tauchen. Schnorcheln am Riff: In der Stille unter Wasser schweben bunte Fische in Zitronengelb und Tabasco-Rot durch bizarr gewachsene Korallengärten. Pelikane segeln im Tiefflug über die kristalline See. Das ist einer der Handvoll Ankerplätze, die weltweit unvergleichlich sind. Sagt selbst Klaas. Ja: Vor Cayo Cuervo zeigt sich die Karibik besoffen schön wie im Werbespot für Havanna-Club.
Segeln Kuba
Dinner bei Sonnenuntergang. Eine sanfte Passatbrise kühlt die sonnenverbrannte Haut, Compay Segundo swingt aus den Boxen und der Himmel über Kuba ertränkt sich in Purpur, Indigo und Violett. Es gibt frisch am Riff gefangenen Hummer, in Knoblauch gebraten, dazu Avocado-Salat und eisgekühlten Chardonnay. Dann liegen wir satt und selig auf dem Vorschiff, unser schwimmendes Hotel schaukelt sacht auf den Wellen und in der lauen Luft feiert die Crew einträchtig vereint eine neue lässige Nacht unter diesem südlichen Himmel voller Sterne. Bis die Mosquitos sirren. Und wir in die Kojen flüchten.
Die Tage auf See vergehen fortan im steten Wechsel zwischen Ankerlichten und Ankerfall. Cayo Macho, Cayo Zaza, Cayo Breton: Schwimmen, Schnorcheln, Kartoffeln schälen und Fisch filettieren bei Salsa, Son und Reggae. Das hier, ahne ich, ist die totale Erholung, und Glück schmeckt salzig wie das Meer und hat nur einen Namen: Segeln. Das nächste Telefon meilenweit entfernt, kein Dorf, keine Strandbar, kein Jetset – Christoph hat es zuerst erkannt: »Hier ist einfach nichts los!« Die Cayos von Kuba an Bord einer Yacht, das ist die Karibik zu Entdeckerzeiten. Eine Enklave der Ruhe. Ein magischer Ort, an dem die Zeit vor dem Sündenfall stehen geblieben zu sein scheint.
Dann herrscht Flaute und die Segel flappen trist am Mast. Klaas wirft kurz entschlossen die Diesel-Motoren an und wir nehmen Kurs auf das nächste Cayo, irgendwo hinter dem Horizont. Der Katamaran dümpelt jetzt schwer durch eine öligbleierne See. Das hat Konsequenzen. Nicole beugt sich als erste über die Reling – Fische füttern!
Behutsam steuert der Käptn das Schiff in die schmale Riffpassage Pasa de los Machos. Querab hat Hurrikan Mitchell seine Visitenkarte hinterlassen. Kaputte Bojen auf geknickten Betonpfeilern ragen aus dem Meer wie zerzauste Palmwedel. Die Cayos seien ein schwieriges Segelrevier, erklärt Klaas, im seichten Wasser lauerten Sandbänke und Korallenriffe zuhauf. Auf dem Vorschiff hält deshalb Alejandro, unser kubanischer Bootsmann, Ausschau nach Verfärbungen im Wasser: Helle Flecken, Achtung, Untiefe! Der muskulöse Segelprofi patroullierte zur Zeit des Kalten Krieges als Schiffsingenieur auf russischen U-Booten vor der kubanischen Küste; nach dem Zusammenbruch des Ostblocks heuerte er bei der kubanischen Handelsmarine an. Ein privilegierter Kubaner also, einer der wenigen jedenfalls, die Kuba ab und an den Rücken kehren können.
Alejandro zeigt nach vorn. Dort, sagt er, habe eine Crew ihr Schiff mit Karacho auf ein Riff gesetzt und versenkt. Ende gut, alles gut: Ein Fischerboot nahm sie an Bord. Alejandro ist überzeugt: Yemayá, die afrokubanische Schutzgöttin des Meeres, sei den Seglern hold gewesen.
Plötzlich schreckt uns ein gellender Ruf auf: »Fisch, Fisch!« Christoph hat einen meterlangen Barracuda an der Leine. Zur Hälfte jedenfalls – das Schwanzstück hat sich offenbar ein Hai geschnappt! Im bürgerlichen Beruf Sportmediziner, angelt unser »Doc« auf diesem Törn soviele Seehechte und Thunfische, daß die Crew sich freut, als nach einer Woche auf See schlicht Spaghetti aufgetischt werden.
Die Kameradschaft und der Teamgeist unter den Mitreisenden bleibt fabelhaft. Trotz aller Enge an Bord. Ich schlafe in einer winzigen Kajüte, eigentlich eine Besenkammer zum Preis der Luxus-Suite im Fünf-Sterne-Hotel. Die gute Stimmung auf dem Schiff sei ein Glücksfall, meint Vielsegler Heinrich (»Ich bin 73, aber woaßt was, mia is des wuarscht!«), gerade auf längeren Segeltörns. Der Grund? Wir einigen uns auf ein »Stimmungshoch über Kuba«. Meteorologisch völlig hanebüchen, das Barometer steht auf einem Tiefpunkt. Wie die Versorgungslage an Bord: Bier ist rationiert, der Rotwein aus.
Abwechslung an Bord bieten Begegnungen auf hoher See. Mit den Fischern von Casilda zum Beispiel. Justo Campero, 55 Jahre alt, taucht seit seiner Jugend nach Langusten. Wir hocken auf den Planken der größten staatlichen Fischereistation Kubas, einer windschiefen Holzbaracke auf Palisaden im Meer, und trinken café cubano – mokkastark, kochend heiß, zuckersüß. Draussen gießt es in Strömen. Die Regenzeit am Äquator hat begonnen und da ist selbst die Karibik grau und nichts als grau.
Penetranter Fischgeruch weht mir in die Nase. Im Kühlhaus stapeln sich Rotbarsche und Doraden, Katzen- und Hammerhaie sowie monströs gewachsene Seewelse, manch ein Prachtexemplar über 200 Kilo schwer. Rund 30 Tonnen Fisch holen Justo und seine Genossen in nur zwei Wochen aus den reichen Fanggründen der Cayos. Dazu 60 Tonnen Hummer, die Kuba für 30.000 Dollar je Tonne nach Kanada exportiert. Devisenprofite für die unbezahlten Rechnungen der Revolution!
»Fidel es bueno!« sagt Justo, Fidel sei ein guter Mann. Es gebe mehr zu essen als unter der Diktatur Batistas und seine Kinder konnten studieren, der Sohn sei heute Rechtsanwalt. Ungeachtet seiner Armut schwört der einfache Fischer auf die Errungenschaften der Revolution: „Kuba hat die Rassendiskriminierung beendet und unser Gesundheitssystem ist einzigartig.“ Immerhin: Die durchschnittliche Lebenserwartung der Kubaner liegt heute mit 73 Jahren so hoch wie in Deutschland; die Kindersterblichkeit ist niedriger als in Washington. Zum Abschied tausche ich meine Hose, Rum und Seife gegen kiloweise Hummer. Justo schenkt uns Zucker, ein Engpaß an Bord, weiß der Teufel warum ausgerechnet vor Kuba! Wir winken dann noch lange hinüber zu unseren neuen kubanischen Freunden, den so herzerfrischenden wie sympathischen Fischern von Casilda.
Zehn Tage auf See. Die Macken der Mitsegler sind längst durchschaut. Der eine duscht jeden Tag, bei maximal 500 Litern Süßwasser im Tank durchaus kein Kavaliersdelikt. Zwei Mann schnarchen beim Matratzenhorchen. Ein schwerwiegender Frevel! »Wenn wir ihnen wohl gesonnen sind«, scherzt Heinrich, unser Bayer und die gute Seele an Bord, »werden sie demnächst ins Beiboot ausquartiert.« Klaas achtet penibel auf Ordnung in der Kajüte: »Sonst sieht das hier bald aus wie ein Kinderzimmer.« Auf einem Schiff, sagt Klaas, gehe es letzlich um die Frage wie man »in Überlebensgemeinschaften klarkommt.«
Die Disziplin an Bord ist jedenfalls strukturiert wie kubanischer Sozialismus: Im Prinzip gilt die Crew als Team, aber entscheiden tut el jefe. Auf dem Schiff, anders als an Land, funktioniert das Modell ganz ohne Widerspruch. Wir sitzen ja sprichwörtlich „in einem Boot“ – das seemännische Können des Käptns entscheidet über Gedeih und Verderb.
Landgang in Trinidad. Die herrschaftlichen Fassaden der kolonialen Stadtpaläste mit ihren schmiedeeisernen Balkonen sind getüncht in Ochsenblutrot, Altrosa, Lindgrün. Die Luft flirrt in der sengenden Hitze. Jung und alt spazieren durch die Gassen aus Kopfsteinpflaster, als wäre das ganze Leben ein langer, nicht endenwollender Sonntagnachmittag.
Das koloniale Kuba gleicht einem blumengeschmückten Patio, parfümiert mit einem Hauch Melancholie.
Wir fahren durch endlos rollende Felder des süßen Rohrs. Halt am Herrenhaus des Iznaga-Clans, nordöstlich von Trinidad. Eine hochgeschwungene Veranda, Sessel im Stil von Louis-XVI., üppige Kristallüster an der Decke, im Park zierliche Königspalmen und dahinter das saftige Grün des sich im Wind wiegenden Zuckerrohrs – man wähnt sich befangen in einem schrecklich-schönen Idyll. Hier riecht alles nach dem bittersüßen Gestern der Kolonialzeit und die Flammenbäume leuchten rot wie Blut. Vor dem Herrenhaus erhebt sich die Torre de Iznaga als ein steinernes Mahnmal kolonialer Unterdrückung. Von der Spitze des neoklassischen Turms in 50 Meter Höhe überwachten die weissen Herren ihre Sklaven. Über eine Million Afrikaner wurden bis 1886 nach Kuba verschleppt – zur Produktion von Zucker, dem weißen Gold der Antilleninsel und zugleich ihrer Geißel. Auf zehn Jahre schrumpfte die restliche Lebenserwartung der Sklaven während ihrer Fron auf den Plantagen.
In den vergangenen vierhundert Jahren hat Zuckerrohr als koloniale Monokultur die Hälfte aller fruchtbaren Felder Kubas erobert; trotz bester Böden können die Bauern bis heute kaum die Bevölkerung mit Kartoffeln, Mais und Bohnen versorgen. Trinidad, dieses koloniale Kleinod Kubas an den Hängen der Sierra del Escambray, hat sich erst mit dem Tourismus-Boom der 90-er Jahre aus der Abhängigkeit vom Zucker befreien können.
Abends ankern wir vor Cayo Blanco. Gegen Mitternacht frischt der Wind auf. Gurgelnd brodelt rings um die Reling die Stunden zuvor noch so friedliche See. Es blitzt und donnert. Windstärke acht: Der Orkan heult in den Stagen und treibt Gischtschwaden über Deck. Die »Lea« bockt wie eine wildgewordene Kuh. Regentropfen peitschen mir ins Gesicht.
Plötzlich löst sich der Schiffsanker. Wir treiben ab. Wieder und wieder rasselt der Anker in die schwarze Tiefe, bis er endlich greift. Wer die Gewalt hereinwaschender Brecher im Sturm erlebt hat, weiß das Meer zu fürchten und wirft auch die letzte Illusion einer besinnlichen Segelromantik endgültig über Bord.
Erst im Morgengrauen flaut der Wind ab. Die Wellen legen sich. Zwischen den Wolken schimmert Himmelsblau durch. Dann zaubert die aufgehende Sonne wieder Milliarden von glitzernden Reflexen in die karibische See zwischen den Cayos vor Kuba.