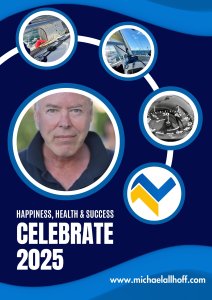Cowboy-Alltag in Oregon: Rinder treiben, Pferde zureiten, Schmerzen ertragen. Zu Gast auf der „Ponderosa Cattle Ranch“
Von Michael Allhoff (text & photos)
„Ich werd´ Cowboy!“ Andere Kinder mochten Pilot werden wollen, Feuerwehrmann oder Rennfahrer. Doch mich hatte von klein auf das freie Leben im Sattel fasziniert. Als Junge war ich mit Old Shatterhand und Winnetou über die Prärie geritten – im Licht der Taschenlampe unter der Bettdecke. Und bald der romantischen Sehnsucht nach dem Wilden Westen verfallen. Jahre später realisiert sich der Traum – und sei es nur für ein paar Tage. Ich bin zu Gast auf der Ponderosa Cattle Ranch – beim round-up, dem Zusammentreiben der Rinder.
Mittags kennt die Hochwüste Oregons keine Schatten. Senkrecht flimmern die Sonnenstrahlen aus einem wolkenlosen Himmel auf das dürre Land, kärglich bewachsen mit olivgrünem Gestrüpp. Es ist ein prasselndes, kalkweißes Licht. Staubwolken flirren über der Steppe. Seit Sonnenaufgang sitze ich im Sattel. Nur das Klappern der Hufeisen auf der steinigen Erde ist zu hören. Der Wind, der in den Kiefern rauscht. Keine Straße, kein Haus, kein Auto: Die Kraft der Hochwüste erlebt erst, wer die wilde Weite zu Pferd entdeckt. Schritt für Schritt. Kilometer um Kilometer. Mehrere Tage lang in der Zeitlosigkeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Die Zunge haftet trocken am Gaumen. Ich schwitze. Ich habe Durst. Ich trinke einen Schluck Wasser und reite weiter. Die Haut an der Innenseite meiner Oberschenkel brennt wie Feuer – wundgeritten!

„Das ist hier nach wie vor der wilde Westen“, sagt Izzy Oren und zeigt mit ausgestrecktem Arm in die Ferne als wollte er das ganze Land umarmen, die Berge, die Wälder, die Wüste. Der Boss der Ponderosa Ranch sieht aus, als wäre er in einem John-Wayne-Western aus der Leinwand gestiegen. Seinen schwarzen Hut hat sich der Zwei-Meter-Mann tief in die Stirn geschoben. Im Mundwinkel, unter dem Schnauzbart, hängt lässig eine milde „Backwoods“-Zigarre. Er trägt lange Ledergamaschen über Wrangler-Jeans. Klirrende Sporen an den Stiefeln. Und einen 22-er Colt im Hüfthalfter.

Die Ponderosa Ranch im Nordwesten der USA hat amerikanisches XXL-Format. Über 4.000 Black-Angus-Rinder grasen verstreut auf 50.000 Hektar Land – einer Fläche von der Größe ganz Berlins. Nur eine Stromleitung erinnert an das 21. Jahrhundert. „Oregon ist der letzte Landstrich Nordamerikas“, sagt Izzy, „wo der Mythos des Cowboy´s noch lebendig ist.“
In dieser einsamen Landschaft grast irgendwo weit verstreut das Vieh. Die Rinder müssen vor dem ersten Schneefall auf ihre Winterweiden getrieben werden. Für Garth Johnson und Brice Meyer ist es ein Tag wie jeder andere. Er begann früh morgens mit Kaffee und Spiegeleiern. Dann hatten die Cowboys der Ponderosa Ranch die Pferde im Korral gestriegelt, gesattelt und gezäumt. Es sind derbe Profis mit krummen Reiterbeinen und wettergegerbten Gesichtern, die wenig Worte über ihren Job verlieren.
Da, zwischen den Felsen, steht eine Gruppe Black Angus. Wir kreisen die Tiere ein und scheuchen sie mit yehaa und hey, hey zu Tal. Immer wieder versuchen widerborstige Kälber den Reißaus. Wir preschen hinterher. Querfeldein im Galopp. Laut blökend traben die Rindviecher widerwillig zurück in die Herde. Am Abend haben wir 236 Tiere zusammen. „A good day“, meint Izzy.
Fünf Uhr morgens beginnt der neue Tag im wilden Westen. Der Vollmond hängt wie ein riesiger Silberdollar über der Bergsilhouette. Die Pferde weiden im Freien. Im ersten Sonnenlicht knattert Brice auf dem fourwheeler über die Wiese. Mit fliegenden Mähnen galoppieren dreissig Pferde von der Koppel in den Korral. Es sind kräftige, ausdauernde Tiere, Apaloosa zumeist und Quarterhorse. Darunter auch Mustangs – Pferde so wild wie das Land.
Heute ist action angesagt im Korral. „Wir trennen die Kälber von den Kühen“, ordert Garth, „zum Impfen!“ Schleier aus Staub wehen über dem Labyrinth aus rostigen Metallgattern, Zäunen und Laufgängen. Hier findet man die wahre Welt des Cowboys – ein rauer Arbeitsplatz jenseits von Lagerfeuer-Romantik, Karl-May-Klischees und Western-Folklore. Hier riecht es nach Kuhmist und Pferdeschweiß, nach Holzkohle und verschmorter Rinderhaut.
Ich reite mitten hinein in die Herde. Panisches Muhen gröhlt aus den Kehlen der Rinder. Tier nach Tier verfolgen wir im Zickzackritt quer durch die Arena und jagen es in das schulterbreite Laufgitter, wo Garth bereits mit der Spritze wartet. Die yearlings, meist über 400 Kilo schwer, kämpfen bockend um den Platz an der Seite ihrer Mutter. Die Rinder flüchten, als liefen sie um ihr Leben. Tatsächlich steht ihr Abtransport im Vieh-Truck bevor. In großen feedyards werden die Kälber einen Monat lang mit Heu gemästet, auf Viehauktionen versteigert, geschlachtet und zerlegt. Zu saftigen Steaks. Und neuen Hamburgern.
Nach dem Lunch – Tee und Kaffe, belegte Brote – reiten Izzy und ich zur „Deep Creek Pasture“. Auf den felsigen Hügeln finden unsere Pferde nur mühsam ihren Tritt. Erst als die Sonne tief über den Bergen steht, entdecken wir endlich das erste Rind. Es ist ein mächtiger Stier. „Wenn er angreift, mach´ dich aus dem Staub“, warnt Izzy, „dieser Stier rennt dein Pferd über den Haufen, wenn er es seitlich unter dem Bauch erwischt.“
Der Stier unternimmt seinen ersten Ausfall. Yehaa! Ich knalle die Zügelenden auf die Flanken des Pferdes. Skip macht einen Sprung nach vorn, wechselt in gestreckten Galopp und holt das Rind in Sekundenschnelle ein. Irritiert bleibt der Stier stehen und dreht sich um. Aus seinem Maul geifert Schaum. Seine Augen quellen aus dem mächtigen Kopf hervor, der hin und her pendelt, während der tonnenschwere Muskelprotz nach einer neuen Fluchtmöglichkeit schielt. Doch Izzy versperrt dem Bullen den Weg zurück. Gewonnen! Vorsichtig Abstand haltend treiben wir den Stier weiter Richtung Ranch.

Abends gibt´s saftig gebratene Steaks. Zum Nachtisch Sahnetorte mit Waldbeeren. Die herzhafte Küche der Ponderosa Ranch gleicht die Strapazen des Tages aus. Reiterferien auf der Ranch gestalten sich durchaus komfortabel – jedenfalls nach Sonnenuntergang. Vor dem Fenster pirschen Antilopen und Hirsche in der Dämmerung zur Tränke an den See. Nach neun Stunden im Sattel habe ich stechenden Muskelkater in Armen und Beinen. Mein Rücken tut weh. Der Hintern schmerzt, wundgeritten bis auf´s Fleisch. Es ist früh am Abend, doch ich will nur ins Bett. Keine zehn Pferde bringen mich heute noch an die Bar.
Der vierte Tag im Sattel. Die Freiheit, die ich suchte, ich finde sie auf dem Rücken der Pferde. Auf der Ebene vor der Ranch lasse ich meinem Tier die Zügel, stelle mich in den Steigbügeln auf, höre das dumpfe Trommeln der Hufe und sehe Wolken, Berge und Bäume vorüberfliegen. Mein Blut pocht in den Schläfen. Da wird etwas in mir ganz ruhig und ich will nichts mehr. Nur noch so weiterreiten, im Galopp von einem Rand des Horizonts zum nächsten.
Ohne Zweifel: Es gibt sie noch, die Cowboys. Aller modernen Technik zum Trotz. „Funkgeräte“, sagt Izzy, „erleichtern die Kommunikation in der Wildnis.“ Und mit PS-starken Pickups seien entfernte Weiden schneller zu erreichen. Ansonsten habe sich der Alltag des Cowboys in Oregonseit hundert Jahren kaum gewandelt. „Cowboys“, meint Izzy lakonisch, „sind einfach Männer, die mit Rindern arbeiten.“
Oder Zäune ausbessern. Auf der Ponderosa Ranch müssen 240 Meilen Stacheldraht in Schuss gehalten werden. Die Rinderhirten beschlagen Pferde mit neuen Hufeisen, brandmarken Rinder, fangen Kälber mit dem Lasso ein – ein harter Arbeitstag. „A cowboy´s work is never done“, zitiert Izzy ein Sprichwort des Wilden Westens.
Plötzlich hallt ein trockener Knall über die Prärie. Garth hat einen Kojoten geschossen. Ein Bulle hatte den Kojoten auf die Hörner genommen. Sein Hinterlauf war blutig zerissen. „The best thing I could do for him!“ meint der 54-jährige Mann. Garth ist im Sattel groß geworden. Er arbeitet seit 25 Jahren als foreman der Ponderosa. „I´m still an ole century cowboy“, meint der bedächtige Reiter. Ein Cowboy from the old breed, vom alten Schlag der Westmänner, die fast schon ausgestorben sind.
„Als ich anfing“, erinnert sich Garth, „grasten noch 800 Büffel in diesem Tal.“ Doch die Büffel sind tot. Und die Ureinwohner Amerikas, die sich einst von der Büffeljagd ernährten, leben alkoholisiert und in ihrer Seele gebrochen in armseligen Reservaten.
Dabei liegt die Eroberung Oregons kaum 140 Jahren zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts strömten Hunderttausende weißer Siedler in den Nordwesten der USA, im Rush auf Goldnuggets. Auf den Spuren des legendären Oregon Trail, 2 000 Meilen durch eine gnadenlos unwegsame Wildnis. Um 1860 errichteten ein paar dieser Pioniere des wilden Westens eine erste Hütte am Snake River. Das windschiefe Blockhaus verwittert verlassen in einem Seitental der Ponderosa Ranch – Zeugnis und Mahnmal zugleich eines ehrlosen Kapitels der amerikanischen Geschichte.
Tags darauf wabert wieder die Gluthitze der Wüste über dem weiten Land. Kyle Lane strafft die Zügel eines Mustangs im Korral. Er zurrt die Lederriemen am Bauchgurt fest. Seine Augenlider zucken nervös, als er mit ruhiger Stimme das tänzelnde Pferd beruhigt. Sind die Zügel zu kurz, reisst mich der bronc nach vorne über; sind sie zu lang, werde ich nach hinten abgeworfen. „Damned“, sagt er, „das geht schnell, dann fliegst du in hohem Bogen in den Dreck!“
Ich setze vorsichtig einen Stiefel in den Steigbügel, ziehe mich langsam am Sattelknauf hoch und schwinge mich in den Sattel. Das Pferd wiehert, steigt auf die Hinterbeine, bockt. Dann rast der bronc mit angelegten Ohren im gestreckten Galopp über die Ebene. Speichel fliegt aus seinen schnaubenden Nüstern. Ich lege mich nach vorne und kralle mich in der schweißnassen Mähne fest. Wer einmal auf dem Rücken eines durchgehenden Pferdes saß, weiß die Tiere fortan zu respektieren. „Sattel´ kein Pferd, das du nicht selber reiten kannst“, lautet die erste Cowboy-Maxime. Eine praxisnahe Weisheit, die vor Blessuren schützt.
Kyle hat als Rodeo-Reiter in Kalifornien gearbeitet. In der Professional Rodeo Cowboys Association. Für abenteuerlustige Männer in den Millionenmetropolen des Westens verkörpert die PRCA einen elementaren, ur-amerikanischen Nervenkitzel. Doch irgendwann hatte der 23-jährige Cowboy die halsbrecherische Show satt. „Ich gab eine Stellenanzeige in L.A. auf“, sagt er und schiebt sich eine Prise Kautabak unter die Oberlippe: „Cowboy looking for work“.
Zu den klassischen Disziplinen des amerikanischen Rodeo gehört das Reiten ungezähmter Pferde mit Sattel (saddle bronc riding), ohne Sattel (bareback riding), Bullenreiten (bull riding), Kälber mit dem Lasso fangen und fesseln (calf roping) sowie steer wrestling – ein tollkühner Wettbewerb, bei dem ein Ochse mit bloßen Händen niedergeworfen werden muß. Preisgelder sind die eigentliche Verlockung in der Arena. Kyle war gut: Siegerprämie in Winchester 1998 – 1000 Dollar auf die Hand! Doch Rodeo-Reiten ist ein brutaler Sport. Die Wenigsten bleiben länger dabei. „Tough shit“, sagt Kyle und spukt ein Quantum Tabaksaft in den Staub.
Reich wird er auch als Cowboy nicht werden. Die Besten verdienen 1500 Dollar. Dazu Extras wie wöchentliche Fleischkontingente und mietfreies Wohnen. Nein, es sind andere Motive, die Männer wie Kyle oder Garth in den Sattel bringen.
„Wenn ich sterbe“, sagt Izzy Oren, „will ich dieses Bild vor Augen sehen: Cowboys hoch zu Pferd, die durch die Wälder reiten“. Wenn der Rancher vom Cowboy-Alltag erzählt, spürt man, wie sehr er dieses Leben unter freiem Himmel liebt. Es ist wohl so: Pathos und Mitgefühl, Eigensinn und Herzlichkeit liegen im Herzen eines Cowboys dicht beieinander.
Doch eigentlich führt Izzy die „Ponderosa Cattle Company“ ökonomisch nüchtern wie einen modernen Industriebetrieb. Es ist auch seine einzige Chance, um im Auf und Ab der Weltmarktpreise Geld zu verdienen. „Das Pfund Fleisch lag vor zwei Monaten noch bei 85 Cents“, sagt der dynamische Rinderkönig, „heute ist der Preis auf 66 Cents gefallen. Wer jetzt verkaufen muß, macht Verlust.“
Es ist kurz nach Sonnenuntergang. Mein Gesicht ist von der Sonne verbrannt. Verschwitzt, verstaubt und erschöpft sitzen wir an der Bar. Zeit für ein paar Bier und einen Whisky. Anstoß zum Billard. Ein Knall, gefolgt vom Klackern der Kugeln auf dem Tisch. In den Gläsern auf der Theke fällt der Bierschaum zusammen, weil sich die Spieler, konzentriert über das Tuch gebeugt, in einer neuen Partie Neuner-Ball verloren haben.
Aus der Juke-Box leiert ein Country-Klassiker von George Strait, And the cowboy rides away. Dann spielt die museumsreife „Rock-Ola 442“ eine Ballade von Waylon & Willie: Mamas, don´t let your babies grow up to be cowboys… – Mütter, lasst eure Kinder keine Cowboys werden… Es sind Lieder, die von der Sehnsucht nach Liebe und der guten alten Zeit handeln. Von der Freiheit, dem Mut und der Unabhängigkeit des Cowboys, dieser verklärten Symbolgestalt Amerikas.